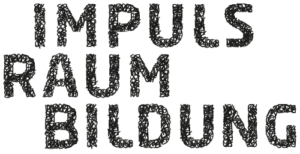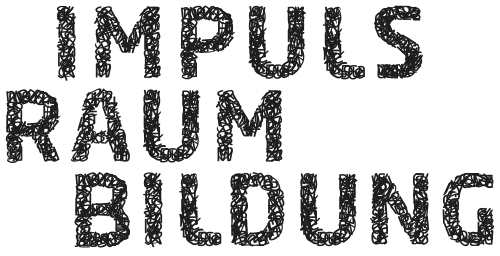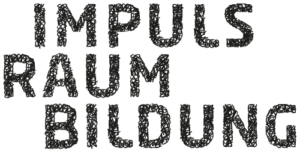Wir haben den Krieg vor der Haustüre und täglich werden wir mit Schlagzeilen zu Katastrophen überhäuft. Wir hören von Gewalt an Kindern und denken, es betrifft uns nicht. Nicht in unserer Welt, nicht in meiner Blase. Doch wir wissen nicht, welche Kinder zu uns in die Schule kommen, was sie erleben mussten, was sie aushalten mussten oder müssen. Dieser Artikel richtet sich explizit an Pädagog*innen, denn es ist unser Job für alle Kinder zu sorgen.
Trauma und Kinder
Der Begriff wird momentan inflationär benutzt. Viele verwenden den Ausdruck für kleinere oder größere Unpässlichkeiten des Alltags. Hier ist es gut, wenn wir uns die Definition der WHO anschauen:
Ein Trauma ist „…ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde.“
Entscheidend ist hier einerseits der Ausdruck „bei fast jedem“, andererseits muss man sagen, dass ein belastendes Ereignis von jedem subjektiv anders wahrgenommen wird. Ob es zu einer Traumatisierung kommt, wird durch die biographischen Faktoren jeder einzelnen Person, die Resilienz Fähigkeit und das Umfeld, in dem die Person eingebettet ist beeinflusst.
Zudem werden kollektiv erlebte Naturkatastrophen in der Regel besser verarbeitet als von Menschen gemachte massive Gewaltausübung, wie eine Vergewaltigung oder das Miterleben einer Verletzung oder der Tötung eines geliebten Menschen. Große Katastrophen sind offensichtlich, man muss nichts erklären, Hilfe ist meist schnell vor Ort und es gibt Menschen, mit denen man darüber reden kann. Bei menschengemachten Gewalterfahrungen spielen häufig Scham, Schuld und Geheimhaltung eine große Rolle. Diese treiben den Stachel der Traumatisierung immer tiefer und verstärken so das Gefühl ausgeliefert und ohnmächtig zu sein.
Tatsache ist, dass wir in den meisten Fällen in der Schule über die Biografie eines Kindes nur wenig wissen. Wenn wir ein Kind besser kennen, lassen manche Verhaltensweisen auf bestimmte Erlebnisse schließen, doch das können maximal Vermutungen sein.
Wie kommt es zu einem Trauma
Ein Trauma kann von einem einzelnen einschneidenden Ereignis ausgelöst werden, aber auch von einer länger andauernden immer wieder auftretenden Bedrohung. Bei Kindern sind das häufig:
- Vernachlässigung
- seelische Misshandlung
- körperliche Misshandlung
- Gewalt in der Familie (häusliche Gewalt)
- Traumatische Sexualisierung
- traumatische Trennungen
Wenn wir normalerweise in eine bedrohliche Situation kommen, reagieren wir blitzschnell. Wenn wir zum Beispiel wahrnehmen, dass ein Ball auf uns zufliegt, ducken wir uns weg oder fangen den Ball. Hierfür verantwortlich ist der älteste Teil unseres Gehirns, das sogenannte Reptiliengehirn. Manchmal, wenn eine Flucht oder die Abwehr aussichtslos erscheinen, kann es auch sein, dass wir erstarren. Diese Reaktionsmöglichkeiten sind unter „flight, fight or freeze“, also „fliehen, kämpfen oder einfrieren“ bekannt. Bei einer akuten Bedrohung haben wir oft nicht die Zeit, die Situation zu bewerten, das Für- und Wieder einer möglichen Reaktion abzuwägen.
Bei einem potenziell traumatisierenden Ereignis sind uns diese Möglichkeiten genommen. Das tritt häufig bei menschengemachten gewaltvollen Ereignissen auf. Wir sind dem Täter oder der Täterin schutzlos ausgeliefert. Wir können weder fliehen noch uns wehren oder tot stellen. In so einer Situation ist die normale Verarbeitung des Ereignisses gestört. Das Ereignis kann nicht in unserem Gehirn integriert werden.
Dieser Kontrollverlust hat psychische und körperliche Folgen. Kinder, die traumatisiert sind, haben permanent das Gefühl bedroht zu sein. Entsprechend verhalten sie sich. In der Traumapädagogik gilt die Grundhaltung: Alles, was ein Mensch zeigt, macht Sinn in seiner Geschichte. Das Kind zeigt eine normale Reaktion auf eine unnormale Umwelt.
Was bedeutet das für die Schule?
Traumatisierte Kinder leiden häufig unter hoher Anspannung, sind leicht reizbar, haben Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle oder zeigen aggressives Verhalten. Es kann sein, dass sie Schwierigkeiten mit der Konzentration haben, leicht schreckhaft sind oder gedanklich so weit abdriften, dass sie nicht ansprechbar sind. Die Diagnose und Therapie obliegt Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen.
Mit oder ohne Diagnose, kann in der Schule einiges getan werden, um für alle Kinder die Schule zu einem sicheren Ort zu machen, in dem Beziehung und Entwicklung möglich sind. Dazu gehört unter anderem auch Verhaltensweisen zu hinterfragen, Handlungsalternativen anzubieten und Geduld und Ausdauer zu beweisen.
Was ist hilfreich?
Ermöglichen Sie den Kinder echte Partizipation. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit fördert die Entwicklung der Selbständigkeit und wirkt dem Kontrollverlust entgegen. Fördern Sie das Miteinander. Zugehörigkeitsgefühl ist für die Entwicklung der Identität so wichtig. Informieren Sie sich über Fortbildungen für Ihre Schule und achten Sie ganz besonders auf sich. Nur starke Pädagog*innen, die gut für sich sorgen, sind in der Lage auch für andere zu sorgen.